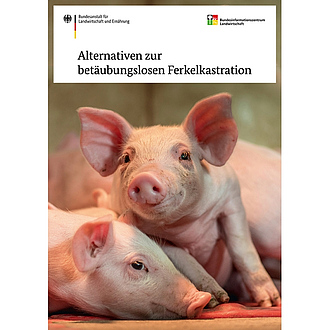Ferkelkastration: nur noch mit Betäubung
Letzte Aktualisierung: 8. Oktober 2025
Seit 2021 ist in Deutschland die betäubungslose Ferkelkastration verboten.

Quelle: BLE
In Kürze
- Männliche Ferkel werden kastriert, um den sogenannten Ebergeruch im Fleisch zu verhindern.
- Der Geruch entsteht beim Erhitzen des Fleisches und macht es schwer verkäuflich.
- Die betäubungslose Kastration wurde lange praktiziert und war für die Tiere sehr schmerzhaft.
- Seit 2021 ist sie in Deutschland verboten – ein wichtiger Schritt für das Tierwohl.
- Heute gibt es drei Alternativen: Kastration unter Betäubung, Immunokastration und Ebermast.
Das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration ist ein großer Fortschritt in Sachen Tierwohl. Für die deutschen Ferkelerzeugerinnen und -erzeuger war es eine große Umstellung. Denn in der Schweinezucht wurden in der Regel alle männlichen Ferkel kastriert. Dies war bis zum siebten Lebenstag ohne Betäubung erlaubt.
Der Grund, warum Ferkel überhaupt kastriert werden, ist: Bei einem geringen Anteil des Jungeberfleisches kann es beim Erhitzen zu einem sehr unangenehmen Geruch kommen – dem "Ebergeruch". Er sorgt dafür, dass das Fleisch nur schwer oder gar nicht verkäuflich ist. Kastriert man männliche Ferkel, wachsen sie nicht zu Jungebern heran, sondern bleiben sogenannte "Börge".
Tierschützerinnen und Tierschützer kritisierten die Praxis der betäubungslosen Kastration schon sehr lange. Der Bundestag hatte 2013 eine Änderung des Tierschutzgesetzes beschlossen, nach der ab 2019 die Ferkelkastration in Deutschland nur noch unter Betäubung zulässig sein sollte. Diese Frist wurde Ende 2018 um zwei Jahre verlängert. Seit dem 1. Januar 2021 ist nun endgültig Schluss mit der betäubungslosen Kastration.
Welche Alternativen stehen Schweinehaltungsbetrieben zur Verfügung?
Die Alternativen
Die in Deutschland zulässigen Alternativen sind die Kastration unter Narkose, die Immunokastration und die Ebermast:

Quelle: BLE, Foto: Christian Mühlhausen (Landpixel)
Kastration unter Narkose
Eine Möglichkeit ist die Durchführung der chirurgischen Kastration unter Narkose, also unter vollständiger Schmerzausschaltung – so wie es das Tierschutzgesetz vorschreibt. Derzeit kommen dafür zwei Betäubungsverfahren in Betracht: die Injektionsnarkose und die Inhalationsnarkose. Bei der Injektionsnarkose wird das Betäubungsmittel mit einer Nadel injiziert. Sie darf nur von einem Tierarzt oder einer Tierärztin durchgeführt werden. Die Inhalationsnarkose, bei der die Tiere über eine spezielle Apparatur das Betäubungsgas Isofluran einatmen, darf auch durch Landwirtinnen und Landwirte angewendet werden, wenn diese über einen entsprechenden Sachkundenachweis verfügen. Bei beiden Verfahren müssen die Tiere anschließend mit Schmerzmitteln für die Behandlung des Wundschmerzes versorgt werden.
Immunokastration
Ein zweiter Weg ist die sogenannte Immunokastration. Dabei handelt es sich um eine Impfung gegen Ebergeruch. Das Fleisch der Tiere wird durch die Impfung nicht nachteilig beeinflusst. Die Impfung unterdrückt bei den Tieren zuverlässig die Produktion von Geschlechtshormonen. Nach außen sichtbar wird dies durch deutlich kleinere Hoden. Das verwendete Tierarzneimittel ist ein EU-weit zugelassener Impfstoff, der weltweit bereits seit längerem mit Erfolg eingesetzt wird. Verabreicht wird er über zwei Injektionen, die im Abstand von mindestens vier Wochen durchgeführt werden. Die zweite Impfung muss zwischen vier und sechs Wochen vor der Schlachtung verabreicht werden. Bis die Wirkung der zweiten Impfung einsetzt, werden die Tiere als intakte Eber gehalten.
Ebermast
Eine weitere Alternative ist die Ebermast. Die Mast von intakten Ebern ist aus Tierschutz-Sicht die am wenigsten umstrittene Methode, weil die Kastration beziehungsweise Eingriffe gänzlich entfallen. Sie funktioniert, wenn man einige Dinge beachtet. Zum Beispiel müssen Jungeber mehr Futterplätze als Börge haben und ihre Buchten sollten möglichst sauber sein. In schmutzigen Buchten besteht eine größere Gefahr, dass sich der gefürchtete Ebergeruch entwickelt. Auch muss das Futter für die Jungeber anders zusammengesetzt sein als für Börge. Um Trächtigkeiten vor der Schlachtung zu vermeiden, müssen Eber und Sauen getrennt aufgestallt werden.
Doch die Mühe lohnt sich: Jungeber haben eine günstigere Futterverwertung als Börge. Sie benötigen bis zu einem halben Kilogramm weniger Futter, um ein Kilogramm Körpersubstanz zu bilden. Außerdem bilden sie höhere Fleischanteile bei weniger Speckauflage. Im Schlachthof angekommen riechen nur drei bis fünf Prozent der Eber so stark, dass man ihr Fleisch nicht ohne Weiteres vermarkten kann. Dieser Wert soll durch Forschungsprojekte zur züchterischen Selektion von Schweinen mit geringem Ebergeruch sowie zur Reduzierung des Ebergeruchs durch gezielte Fütterung weiter reduziert werden.
Weitere Informationen
Bundeslandwirtschaftsministerium (BMLEH): Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration
Oekolandbau.de: Wie werden Bio-Schweine gehalten?
Nutztierhaltung.de: Betriebsreportage: Jungebermast mit Immunokastration
Nutztierhaltung.de: Betriebsreportage: Inhalationsnarkose mit Isofluran
Nutztierhaltung.de: Injektionsnarkose mit Ketamin und Azaperon