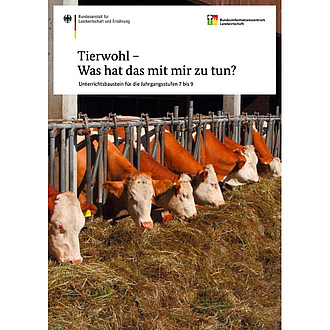Tierwohl – was heißt das konkret?
Letzte Aktualisierung: 10. Okotber 2025
Geht es um Nutztierhaltung, ist oft von Tierwohl, Tierschutz oder Tiergerechtheit die Rede. Was ist damit gemeint und wo liegen die Unterschiede?
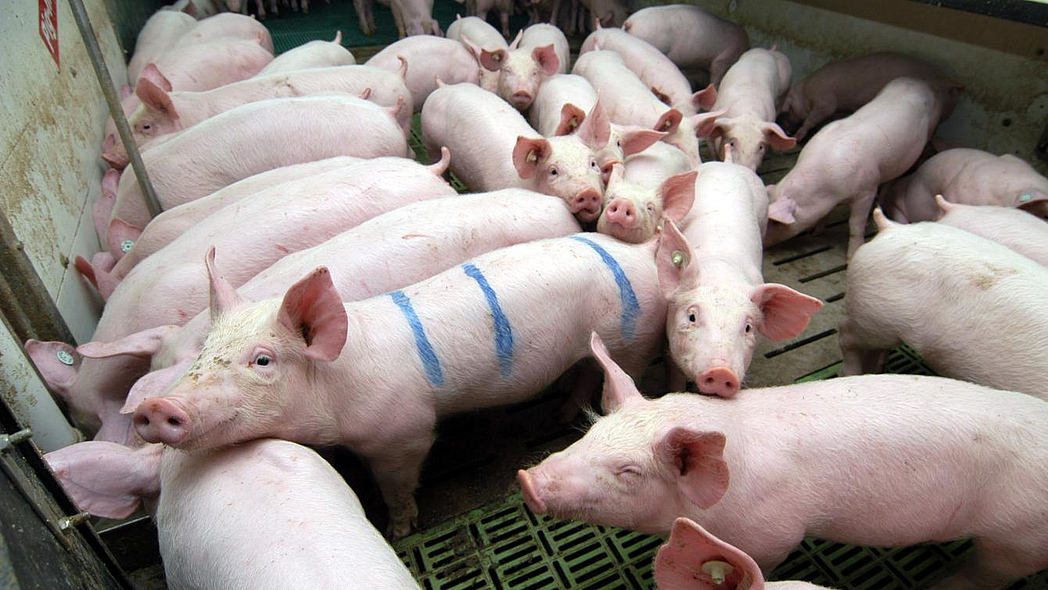
Quelle: landpixel.de
In Kürze
- “Tierwohl” beschreibt den tatsächlichen Zustand des Tieres in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden.
- Der Begriff ist jedoch weder einheitlich definiert noch rechtlich geschützt.
- Ein wissenschaftliches Gutachten bewertet die Haltungsbedingungen in Deutschland als “nicht zukunftsfähig” und forderte grundlegende Reformen.
- Verbraucher- und Tierschutzverbände kritisieren die unklare Verwendung von Begriffen wie “Tierwohl”.
Die intensive Nutztierhaltung, wie sie heute in Deutschland weit verbreitet ist, wird zunehmend kritisch gesehen. Die Kritik kommt dabei schon länger nicht mehr allein von Umwelt- und Tierschutzverbänden. Auch Bedenken von fachwissenschaftlicher Seite werden lauter. Bereits im Jahr 2015 sorgte das Gutachten "Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung" des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (WBAE) für Aufregung. Es ist bis heute ein wichtiger Bezugspunkt der Tierwohl-Debatte in Deutschland.
Darin bewerten die wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter die Haltungsbedingungen in Deutschland "für einen Großteil der Nutztiere als nicht zukunftsfähig". Sie mahnen "erhebliche Defizite im Bereich Tierschutz, aber auch im Umweltschutz" an und fordern "tiefgreifende Änderungen".
Seitdem wird viel darüber diskutiert, was in der landwirtschaftlichen Tierhaltung getan werden muss, damit es den Nutztieren bessergeht. Dabei werden häufig Begriffe wie "Tierwohl", "Tierschutz" und "Tiergerechtheit" verwendet. Deren Bedeutung und Einordnung ist jedoch nicht jedem geläufig. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Begriffe nicht immer einheitlich verwendet werden. Um der aktuellen Diskussion über die Tierhaltung in Deutschland besser folgen zu können, ist es daher gut zu verstehen, woher diese Begriffe kommen, was dahintersteckt und wie sie sich voneinander unterscheiden.

Quelle: wikoski via Getty Images
Tierschutz oder Tierwohl?
Während der Begriff Tierwohl sich darauf bezieht, wie es dem Tier geht, bezieht sich Tierschutz auf das, was getan wird, um das Tierwohl zu sichern. Unter dem Begriff Tierschutz lassen sich also alle rechtlichen Rahmenbedingungen zur Haltung und zum Umgang mit Tieren zusammenfassen, die dem Schutz von Gesundheit, Leben und Wohlbefinden der Tiere dienen.
Grundsätzlich ist in Deutschland der Schutz der Tiere seit 2002 als Staatsziel in Artikel 20a des Grundgesetzes verankert. Allgemeine Anforderungen zum Tierschutz sind im Tierschutzgesetz festgeschrieben, während die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung für die Haltung eines Großteils der Nutztiere detaillierte Vorschriften formuliert. Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung enthält allerdings nicht für alle Nutztiere spezifische Vorgaben. So sind zum Beispiel Mastrinder, Milchkühe und Puten nicht genauer berücksichtigt.
Die rechtlichen Regelungen zum Schutz von Tieren umfassen im Wesentlichen Vorschriften zur Zucht, Tierhaltung und Schlachtung. Es werden aber auch Vorgaben zu den sogenannten nicht kurativen Eingriffen am Tier gemacht. Das sind zum Beispiel Eingriffe wie das Kürzen von Schwänzen bei Ferkeln oder das Enthornen von Rindern.
Die gesetzlichen Vorgaben gelten als absoluter Basisstandard und sollten für jeden Tierhaltungsbetrieb eine Selbstverständlichkeit sein. Betriebe, die darüberhinausgehende Anforderungen für ein Mehr an Tierwohl erfüllen, machen dies auf freiwilliger Basis.
Tierwohl – Wie geht es dem Tier?
Aber was ist Tierwohl überhaupt und wie kann man es messen? Obwohl "Tierwohl" inzwischen der gebräuchlichste Begriff in der Diskussion um eine bessere Tierhaltung ist, gibt es dafür – entgegen der Erwartung vieler Verbraucherinnen und Verbraucher – bislang keine einheitliche Definition.
Laut Prof. Dr. Ute Knierim, Nutztierethologin der Universität Kassel und Mitverfasserin des oben zitierten Gutachtens, bezeichnet Tierwohl den Zustand des Tieres oder der Tiere in einer Herde mit Bezug auf den Grad der Gesundheit und des Wohlbefindens. Das Wohlbefinden bemisst sich aus Sicht der Wissenschaft daran, inwiefern sich ein Tier seinen natürlichen Bedürfnissen entsprechend mit der Umwelt auseinandersetzen und dabei positive Gefühle empfinden kann.
Tierwohl kann es demnach in sehr niedriger bis sehr hoher Ausprägung geben. Tierwohl auf einem sehr niedrigen Niveau wäre dann gleichbedeutend mit: Dem Tier geht es nicht gut und es ist womöglich krank. Ein sehr hohes Maß an Tierwohl wäre dagegen gegeben, wenn das Tier nicht nur gesund ist, sondern sich auch wohlfühlt.
Synonym zu "Tierwohl" wird in der Wissenschaft auch der Begriff "Wohlergehen" verwendet. Weitere Begriffe, die häufig in diesem Zusammenhang gebraucht werden sind "Tiergerechtheit" oder "tiergerechte Haltung". Sie beziehen sich auf das Management und die Haltungsverfahren in der Nutztierhaltung und beschreiben, inwiefern ein Haltungssystem Wohlergehen oder Tierwohl ermöglicht.

Quelle: torwai via Getty Images
Tierwohl messbar machen
Ein grundsätzliches Problem beim Tierwohl ist, dass es in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – aber auch in der Wissenschaft – bislang noch sehr unterschiedliche Einschätzungen darüber gibt, ob es unseren Nutztieren gut oder schlecht beziehungsweise besser oder schlechter geht als in der Vergangenheit. Bislang fehlt es noch an einer fundierten und objektiven Berichterstattung über den Status quo und die Entwicklung des Tierwohls in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Zwar werden bereits Daten zu einzelnen Aspekten des Tierwohls erhoben. Diese ergeben aber kein vollständiges Bild, weil nur bestimmte Tierarten und Produktionsrichtungen erfasst werden oder keine Auswertung bezüglich des Tierwohls erfolgt.
Eine Lösung für dieses Problem wurde in dem Projekt "Nationales Tierwohl-Monitoring" (NaTiMon) gefunden. In diesem Projekt sind über fünf Jahre lang Methoden entwickelt worden, wie Tierwohl flächendeckend gemessen, beurteilt und in geeigneter Weise auf nationaler Ebene dargestellt werden kann, damit ein objektiver Überblick zur Tierwohlsituation zur Verfügung steht und Veränderungen über die Zeit festgestellt werden können. Die Projektbeteiligten haben die Ergebnisse 2023 an das Bundesministerium für Landwirtschaft, ERnährung und Heimat (BMLEH) übergeben. Das BMLEH will den Ansatz eines Nationalen Tierwohl-Monitorings vorerst allerdings nicht weiterverfolgen.
Seit Ende 2023 gibt es jedoch auf EU-Ebene die "Working Group on Animal Welfare Policy Indicators". Diese Arbeitsgruppe soll im Auftrag der EU-Kommission eine Liste mit gut erfassbaren Tierwohlindikatoren für die wichtigsten Nutztiergruppen erarbeiten, die dann künftig regelmäßig EU-weit statistisch erfasst werden sollen.
Verbraucherschutzverbände sehen Tierwohl-Begriff kritisch
Dass solch ein objektiver Maßstab, der die Gesundheit und soweit möglich auch das Wohlbefinden unserer Nutztiere messbar macht, bislang fehlt, ist einer der Gründe dafür, dass Tier- und Verbraucherschutzverbände sowohl die Begriffe "Tierwohl" und "artgerechte Haltung" als auch deren Verwendung kritisch sehen.
So kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), dass die Wörter rechtlich nicht geschützt sind und daher auch für Produkte gelten können, die nur den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen. Dadurch werden Verbraucher:innen leicht in die Irre geführt und nehmen an, das Fleisch stamme aus besonders tierfreundlicher Haltung, obwohl dies häufig nicht zutrifft.
Die Verbraucherorganisation Foodwatch bemängelt, der Wortbestandteil "Wohl" in "Tierwohl" werde von den meisten Verbraucherinnen und Verbrauchern intuitiv mit "Wohlbefinden" assoziiert, was als positives, angenehmes Empfinden wahrgenommen werde. Ist von "mehr Tierwohl" die Rede, suggeriere das also eine Steigerung schon vorhandenen Wohlbefindens, obwohl es häufig lediglich um eine Verminderung von Leid ginge. Hier habe auch der Wissenschaftliche Beirat für Unklarheit gesorgt, der einerseits den Status quo der derzeitigen Tierhaltung für "nicht vertretbar und gesellschaftlich nicht akzeptabel" halte, dessen Verständnis von Tierwohl als Gradmesser aber dafür sorge, dass auch hier bereits von Tierwohl – zumindest in niedriger Ausprägung – gesprochen werden müsse.
Auch tierhaltende Betriebe wollen mehr Verbindlichkeit
Den Wunsch nach mehr Verbindlichkeit in Sachen Tierwohl teilen durchaus auch viele Tierhalterinnen und Tierhalter in Deutschland. Ihnen ist klar, dass die zukünftige gesellschaftlich Akzeptanz der Nutztierhaltung in Deutschland von einem höheren Maß an Tierwohl abhängig ist. Ihr Wunsch: eine Verständigung auf das gesellschaftlich gewünschte Maß an Tierschutz und Tierwohl. Oder, anders ausgedrückt, eine Antwort auf die Frage: Welches Maß an Tierwohl wollen wir und welche Form der Nutztierhaltung akzeptieren wir dauerhaft? Denn die für die Verbesserung der Haltungsbedingungen erforderlichen Investitionen sind zum Teil beträchtlich und bedeuten für Landwirtinnen und Landwirte langfristige Weichenstellungen – etwa beim Stallbau.
Umso wichtiger ist für tierhaltende Betriebe Planungssicherheit dahingehend, dass sie sich nicht schon in wenigen Jahren mit neuen Anforderungen konfrontiert sehen. Ein Dilemma, das sich nur schwer auflösen lässt. Denn während Investitionen und Umbauten langfristige Planungssicherheit erfordern, sind gesellschaftliche Erwartungen einem schnellen Wandel unterworfen. Für einen möglichst kurzfristigen Umbau der Tierhaltung ist ein Mindestmaß an Einigkeit und Verbindlichkeit aber beinahe unverzichtbar. Denn je geringer die Planungssicherheit, desto geringer die Bereitschaft der Betriebe, proaktiv zu handeln.