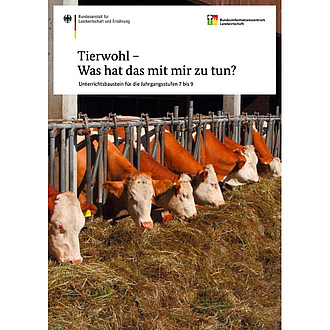Für eine tiergerechtere Nutztierhaltung: Die Labels im Überblick
Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2025
Die Zahl an Labels auf tierischen Lebensmitteln ist groß und verwirrt viele Käuferinnen und Käufer. Wir bringen Licht in den Label-Dschungel.

Quelle: landpixel.de
In Kürze
- Die Vielzahl an Tierwohl-Labels macht es Verbraucherinnen und Verbrauchern schwer, den Überblick zu behalten.
- Das staatliche Tierhaltungskennzeichen und das Label "Haltungsform" der Wirtschaft geben Auskunft darüber, wie die Tiere gehalten wurden, von denen das Fleisch kommt.
- Tierschutz-Labels wie "Für Mehr Tierschutz" und "Neuland" stellen in der Regel höhere Anforderungen an die Haltungsbetriebe.
- Bio (EU-Bio, Bioland, Demeter) fordert außer einer tiergerechten Haltung auch eine Öko-Fütterung.
Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher lehnen eine intensive Nutztierhaltung mit nicht tiergerechten Haltungsbedingungen ab. Wenn es nach ihren Wünschen ginge, hätten Rinder, Schweine & Co. frische Luft, viel Licht und ausreichend Platz zur Verfügung. Gefordert wird ein höheres Maß an Tierwohl in der Landwirtschaft.
Tierwohl, Tierschutz, Tiergerechtheit
Nicht selten werden die Begriffe Tierwohl, Tierschutz und Tiergerechtheit durcheinandergebracht. Trotz Überschneidungen bedeuten sie jedoch nicht dasselbe: Der Begriff Tiergerechtheit bezieht sich auf Management und Haltungsverfahren und beschreibt, inwiefern ein Haltungssystem Wohlbefinden ermöglicht. Während sich Tierschutz auf die Aktivitäten des Menschen bezieht, Tiere zu schützen, wie etwa durch Gesetze, steht bei Tierwohl die Perspektive des Tieres im Vordergrund.
Der Begriff Tierwohl umfasst die Bereiche Haltung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Tiere müssen also gesund sein, sollen sich artgemäß verhalten können und möglichst wenig Stress ausgesetzt sein. Haltungssysteme, die ein hohes Tierwohlniveau erreichen, können als tiergerecht bezeichnet werden.
Bestehende Labels im Überblick
Um Verbraucherinnen und Verbrauchern die Auswahl zu erleichtern, haben verschiedenste Initiativen in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Tierwohlkennzeichnungen entwickelt. Leider ist die Bandbreite an Labeln inzwischen groß, sodass man leicht den Überblick verlieren kann. Wir verraten Ihnen daher im Folgenden, welches Label wofür steht.
Tierhaltungskennzeichen
Mit dem staatlichen Tierhaltungskennzeichen sowie dem privatwirtschaftlichen Label "Haltungsform" gibt es zwei Labels, die den Status Quo der Tierhaltungen, von denen das Fleisch stammt, kennzeichnen.
Staatliches Tierhaltungskennzeichen
2023 ist das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz (THKG) in Kraft getreten. Wenngleich eine Kennzeichnung ab sofort möglich ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern, bis Verbraucherinnen und Verbraucher die ersten gekennzeichneten Produkte in den Kühltheken finden werden. Denn das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz sieht eine zweijährige Übergangsfrist vor, die im Juni 2025 durch die neue Bundesregierung verlängert wurde. Spätestens ab März 2026 wird die Kennzeichnung der Produkte verpflichtend.
Vorerst gilt die Kennzeichnungspflicht nur für unverarbeitetes Fleisch von Schweinen. Laut Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) soll jedoch "zügig eine Erweiterung auf andere Tierarten, die Gastronomie und verarbeitete Produkte" erfolgen. Feste Termine dafür nennt das BMLEH allerdings nicht.
Mit der Tierhaltungskennzeichnung werden Verbraucherinnen und Verbraucher neutral und ohne Wertung darüber informiert, wie die Nutztiere, deren Fleisch sie kaufen , gehalten wurden. Gemeint ist damit zum Bespiel, wie viel Platz und Komfort die Tiere im Stall hatten oder ob ihnen Zugang zu Auslauf oder Weide gewährt wurde. Gekennzeichnet werden fünf verschiedene Haltungsformen (Stall, Stall+Platz, Frischluftstall, Auslauf/Weide, Bio).
Während "Stall" die gesetzlichen Mindestanforderungen an das Wohlergehen der Tiere darstellt, bildet "Bio" den höchsten Standard ab – dazwischen gibt es Abstufungen. Überwacht wird die Einhaltung der Haltungsbedingungen im Rahmen der amtlichen Kontrolle durch die Behörden der Bundesländer.
Zunächst wird nur die Mast in der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung berücksichtigt. Die Produktionsabschnitte Ferkelerzeugung und Ferkelaufzucht sollen aber nach Angaben des BMLEH perspektivisch miteingebunden werden.
Anders als alle anderen Labels ist das staatliche Tierhaltungskennzeichen für Frischfleischprodukte deutscher Herkunft verpflichtend. Mit der neuen staatlichen Tierhaltungskennzeichnung schafft die Bundesregierung damit einen verbindlichen Rahmen, der durch den Staat garantiert und kontrolliert wird.
Mehr Infos: Tierhaltungskennzeichnung
Haltungsform
Das Label "Haltungsform" wurde gemeinsam von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren des Lebensmittelhandels entwickelt und eingeführt. In Anlehnung an das staatliche Tierhaltungskennzeichen werden in fünf Kategorien die folgenden Haltungsbedingungen gekennzeichnet: Stall (rot), Stall+Platz Plus (blau), Frischluftstall (orange), Auslauf/Weide (hellgrün) und Bio (dunkelgrün).
Wie das staatliche Tierhaltungskennzeichen dient das Haltungsform-Label dazu, bestehende Standards und Tierwohlprogramme in ein mehrstufiges System einzuordnen.
Mehr Infos: Haltungsform
"Echte" Tierschutz-Labels
Die im Folgenden dargestellten Tierschutz-Labels unterscheiden sich von den reinen Tierhaltungskennzeichen dadurch, dass durch die Teilnahme neue Anforderungen an die Tierhaltungsbetriebe gestellt werden. Der Kriterienkatalog bezüglich Tiergerechtheit ist hier meist deutlich umfangreicher und die Anforderungen reichen in aller Regel über die reine Haltung hinaus. Auch die Bereiche Transport und Schlachtung werden zum Teil mit einbezogen.
Für Mehr Tierschutz
Der Deutsche Tierschutzbund hat mit dem zweistufigen Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz" eine Kennzeichnung eingeführt, mit der Produkte von Masthühnern, Mastschweinen, Mastrindern, Legehennen und Milchkühen gekennzeichnet werden können. Die teilnehmenden Erzeugerbetriebe werden mindestens zweimal jährlich und unangekündigt von unabhängiger Stelle kontrolliert.
Das Siegel gliedert sich in zwei Stufen:
- Einstiegsstufe
Den Tieren muss mehr Platz zur Verfügung gestellt werden: Für Schweine müssen die Buchten so ausgestaltet sein, dass sie eine Trennung in Funktionsbereiche (Liegen, Fressen und Koten) ermöglichen. Pro Kuh müssen eine komfortable Liegebox und ein Fressplatz vorhanden sein. Bei Mastgeflügel sind ein Außenklimabereich sowie Strukturelemente wie Sitzstangen verpflichtend und Legehennen bekommen zusätzliche Sandbäder und Beschäftigungsmaterial. Das betäubungslose Veröden der Hornanlage der Kälber ist verboten. Vor einem geplanten Transport zur Schlachtung müssen Landwirtinnen und Landwirte sicherstellen und dokumentieren, dass die Kuh nicht trächtig ist.
- Premiumstufe
In der zweiten Labelstufe kommen zusätzlich unter anderem Zugang zu Auslauf (beziehungsweise Laufhof oder Weide) oder Freilandhaltung und ein höheres Platzangebot hinzu.
Eine Besonderheit an diesem Label ist, dass es von Anbietern unabhängig ist. Das heißt, der Tierschutzbund ist lediglich dafür da, zu bestätigen, dass die Tierschutzanforderungen eingehalten werden. Er verdient jedoch nicht am Fleischverkauf mit.
Mehr Infos: Für mehr Tierschutz
Neuland
Alle Neuland-Tiere werden nach strengen Richtlinien artgerecht gehalten. Sie haben mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, ganzjährig Auslauf ins Freie, liegen auf Stroh und bekommen nur regionale, gentechnisch nicht veränderte Futtermittel zu fressen. Tierische Futtermittel wie Fisch- oder Tiermehl sind ebenso verboten wie Leistungsförderer in der Fütterung. Neben diesen allgemeingültigen Richtlinien gelten für die verschiedenen Tierarten weitere, spezielle Anforderungen.
Verglichen mit dem Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz" erfüllt Neuland mit seinen Vorgaben die Anforderungen der Premiumstufe des Labels problemlos, in einigen Bereichen liegen die Neuland-Standards sogar darüber. Mit dem Neuland-Siegel werden Produkte von Mastgeflügel, Mastschweinen, Mastrindern, Legehennen und Schafen gekennzeichnet. Die erzeugenden Betriebe werden mindestens einmal jährlich und unangemeldet kontrolliert.
Mehr Infos: Neuland
Initiative Tierwohl
Hinter der 2015 ins Leben gerufenen Initiative Tierwohl (ITW) stehen Unternehmen und Verbände aus dem Lebensmitteleinzelhandel, aus der Fleischwirtschaft sowie aus der Landwirtschaft. Teilnehmende Betriebe, die sich für mehr Tierwohl einsetzen, erhalten durch die Initiative ein etwas höheres Entgelt. Um zu prüfen, ob die erzeugenden Betriebe die Kriterien einhalten, werden sie mindestens zweimal jährlich kontrolliert, einmal davon unangekündigt.
Die ITW nimmt unter den Tierschutz-Labels eine Sonderrolle ein. Wie die Initiative auf ihrer Internetseite schreibt, verfolgt sie einen "evolutionären Ansatz". Das bedeutet: Die Anforderungen an die Tiergerechtheit bewegen sich auf einem eher niedrigen Niveau. Dafür erreicht die ITW eine breite Masse an landwirtschaftlichen Betrieben, die sich für mehr Tierschutz einsetzen. Laut ITW sei dieser Beitrag ebenso wichtig wie der "revolutionäre Ansatz" wie er in Tierschutz-Programmen wie NEULAND oder "Für mehr Tierschutz" zu finden sei. Diese Programme würden jedoch ein Nischendasein fristen, da nur wenige Betriebe deren Kriterien unmittelbar erfüllen können und nur eine Minderheit der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sei, den entsprechenden Mehrpreis zu zahlen.
Mehr Infos: Initiative Tierwohl
EU-Bio-Logo und Bio-Anbauverbände
Das EU-Bio-Logo sowie die Labels der ökologischen Anbauverbände stehen für die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Lebensmittelerzeugung, umfassen damit also Pflanzenbau und Tierhaltung, aber auch Lebensmittelverarbeitung und den Handel.
Grundlage für die Bio-Tierhaltung ist die EU-Öko-Verordnung. Sie schreibt eine flächengebundene Tierhaltung vor. Das bedeutet, dass der zulässige Tierbesatz von der vorhandenen Fläche abhängt. Außerdem hat die Tierhaltung artgerecht zu erfolgen. Das bedeutet beispielsweise Auslauf oder Weidegang, ein Verbot ausschließlicher Haltung auf Spaltenböden oder präventiver Antibiotika-Gaben. Je nach Tierart gibt es detaillierte Vorgaben wie beispielsweise bestimmte Einstreu, Sitzstangen, Staubbäder, Wasserbecken, Wühlflächen.
Laut EU-Öko-Verordnung soll das Futter für die Tiere überwiegend im eigenen oder einem anderen Bio-Betrieb in der Region erzeugt werden. Ist nicht genügend Futter in Öko-Qualität verfügbar, dürfen in sehr begrenztem Umfang konventionelle Eiweißfuttermittel zugefüttert werden.
Die Richtlinien der deutschen Öko-Anbauverbände Bioland, Naturland, Demeter, Biopark, Gäa, Biokreis, Ecoland und Verbund Ökohöfe gehen teilweise über diese Mindestvorgaben hinaus.
Für den (Schlacht-)Transport von Nutztieren verbietet die EU-Öko-Verordnung den Einsatz von Elektroschockern und herkömmlichen Beruhigungsmitteln. Den Verbänden zufolge dürfen die Tiere maximal vier Stunden lang und 200 Kilometer weit transportiert werden.
Zum Platzbedarf der einzelnen Tiere machen die EU-Öko-Verordnung sowie die Richtlinien der Verbände detaillierte Angaben, die teilweise über die Vorgaben der anderen Siegel hinausgehen.
Mehr Infos: Fragen rund um den Ökolandbau
Haltungskriterien im Überblick
Masthühner
| Masthühner | Maximale Gruppen- größe pro Stall |
Maximale Besatz- dichte |
Auslauf | Mastdauer | Transport- dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzliche Bestimmungen |
k.A. | 39 kg/m2 | nicht vorge- schrieben |
32-46 Tage | k.A. |
| Haltungsform | k.A. | Stufe 1: 39 kg/m2 Stufe 2: 35 kg/m2 Stufe 3: 25 kg/m2 Stufe 4: 21 kg/m² Stufe 5: 21 kg/m² |
Stufe 3: ständiger Zugang zu Außenklimabereich (kein Auslauf) Stufe 4: Zugang zu Freigelände (min. 1/3 der Lebenszeit) Stufe 5: wie 4 aber mind. 4 m2/Tier |
Stufe 3-5: mind. 81 Tage | k.A. |
| Initiative Tierwohl |
k.A. | 35 kg/m2 (im Durchschnitt dreier aufeinander folgender Durchgänge) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Für Mehr Tierschutz |
Einstieg: 30.000 Tiere Premium: 4.800 Tiere |
Einstieg: 25-30 kg/m² und 15-18 Tiere/m² Premium: 25-26 kg/m² und 15-16 Tiere/m² |
Einstieg: Kalt- scharrraum Premium: Kaltscharrraum + 4 m² Auslauf pro Tier, davon 2,5 m² im Radius von 150 m |
Einstieg: |
max. 4 h |
| NEULAND | 4.800 Tiere |
21 kg/m² und 20 Tiere/m², ab dem 29. Lebenstag 21 kg/m² und 10 Tiere/m² |
Grünauslauf mit 4m²/Tier |
mind. 56 Tage |
200 km/4 h |
| EU-Öko- Verordnung |
4.800 Tiere |
21 kg/m² | Grünauslauf mit 4m²/Tier |
mind. 81 Tage |
k.A. |
| Bioland | 4.800 Tiere |
21 kg/m² | Grünauslauf mit 4m²/Tier (bei Mobilställen 2m²/Tier |
mind. 81 Tage |
max. 200 km u. 4 h |
Legehennen
| Legehennen | Maximale Gruppengröße | Maximale Besatzdichte | Auslauf |
|---|---|---|---|
| Gesetzliche Bestimmungen |
6.000 Tiere | 9 Tiere/m2 | Boden- und Freilandhaltung: Kaltscharraum |
| Für Mehr Tierschutz |
Einstieg: 3.000 Tiere Premium: 3.000 Tiere |
Einstieg + Premium: 7 Tiere/m2 | Einstieg: Kaltscharraum Premium: Kaltscharrraum + 4 m² Auslauf pro Tier im Radius von 150 m |
| NEULAND | 1.500 Tiere | 6 Tiere/m2 | ganzjähriger Freilandauslauf mit 4m2/Tier |
| EU-Öko- Verordnung |
3.000 Tiere | 6 Tiere/m2 | Freilandauslauf mit 4m2/Tier |
| Bioland | 3.000 Tiere | 6 Tiere/m2 | Freilandauslauf mit 4m2/Tier |
Mastschweine
| Mastschweine | Flächen- bedarf (gewichts- abhängig) |
Einstreu | Auslauf | Schwanz-kupieren | Transport-dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzliche Bestimmungen |
0,5 - 1 m²/Tier (je nach Gewicht des Tiers) | nicht vorge-schrieben | nicht vorge- schrieben |
erlaubt | max. 24 h |
|
Staatl. Tierhaltungs-kennzeichnung |
Stall: 0,5-1 m²/Tier |
Bei "Auslauf/Weide" (Variante 1) und "Bio" vorgeschrieben |
Auslauf/Weide: 0,25-0,8 m²/Tier
|
k.A. |
k.A. |
| Haltungsform | Stufe 1: mind. 0,75 m²/Tier Stufe 2: mind. 0,825 m²/Tier Stufe 3: 1,05 m²/Tier Stufe 4: 1,5 m²/Tier | k.A. |
Stufe 3: Stall mit Außenklimareiz Stufe 4: Auslauf vorgeschrieben |
k.A. | k.A. |
| Initiative Tierwohl |
10% mehr Platz als gesetzlich vorge-schrieben | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Für Mehr Tierschutz |
Einstieg: mind. 0,65 - 2,1 m²/Tier Premium: mind. 0,8 - 2,3 m²/Tier |
im Liege-bereich | Einstieg: nicht vorgeschrieben Premium: mind. 0,3 - 0,8 m²/Tier | verboten | 200 km / 4 h |
| NEULAND | mind. 0,5 - 1,6 m²/Tier |
im Stall + Auslauf | Je nach Gewicht des Tiers: 0,3 - 0,8 m2/Tier | verboten | 200 km / 4 h |
| EU-Öko- Verordnung |
mind. 0,8 - 1,5 m²/Tier |
im Ruhe- bereich |
mind. 0,6 - 1,2m²/Tier | verboten | k.A. |
| Bioland | mind. 0,8 - 1,5 m²/Tier |
im Ruhe-bereich | mind. 0,6 - 1,2m²/Tier | verboten | 200 km / 4 h |
Mastrinder
| Mastrinder | Platzangebot (gewichts- abhängig) |
Auslauf | Anbinde- haltung |
Kälber enthornen |
Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzliche Bestimmungen |
k.A. | nicht vorge- schrieben |
erlaubt | erlaubt | max. 29 h |
| Haltungsform | Stufe 1: 1,5 - 2,2 m²/Tier Stufe 2: 1,5 - 3 m²/Tier Stufe 3: 1,5 - 4 m²/Tier Stufe 4+5: 1,5 - 5 m²/Tier |
Stufe 4+5: ständiger Zugang zu Auslauf oder Weide |
ab Stufe 2: verboten |
Stufen 1 - 3: erlaubt Stufe 4+5: im Ausnahmefall (mit Betäubung) |
k.A. |
| Initiative Tierwohl | 1,5 - 3 m²/Tier (Mutterkuhhaltung: 5 m²) | k.A. |
Bullenmast und Mutterkuh: verboten Färsen- und Ochsenmast: unter Auflagen erlaubt |
k.A. | k.A. |
| Für Mehr Tierschutz (Mast von Rindern aus Milchkuhbetrieben) |
Einstieg+Premium: |
Premium:
200-300 kg: 2 m² Auslauf 300-400 kg: 2 m² Auslauf 400-500 kg: 3 m² Auslauf ab 500 kg: 0,75 m² pro 100 kg |
verboten |
Nur unter |
200 km, max. 4 h |
| NEULAND | 1 m²/100 kg Lebend-gewicht; Mutterkühe: 5m²/Tier |
0,75 m²/ 100 kg Lebend-gewicht |
verboten | Mit Betäubung nur nach Indikation durch Tierarzt |
200 km / 4h |
| EU-Öko- Verordnung |
1,5 - 5 m²/Tier | 1,1 - 3,7 m²/Tier | Für Klein- betriebe unter bestimmten Voraus- setzungen zulässig |
Kann genehmigt werden | k.A. |
| Bioland | 1,5 - 5 m²/Tier | 1,1 - 3,7 m²/Tier | Für Klein- betriebe unter bestimmten Voraus-setzungen zulässig, bei Jungtieren < 1 Jahr verboten |
Kann genehmigt werden (dann mit Betäubung) | 200 km / 4 h |
Milchkühe
| Milchkühe | Platz- angebot (je Tier) |
Auslauf | Anbinde- haltung |
Kälber enthornen |
Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzliche Bestimmungen |
k.A. | nicht vorge- schrieben |
erlaubt | erlaubt | max. 29 h |
| Haltungsform | Stufe 1: k.A. Stufe 2: 4 m2 Stufe 3: 5 m2 Stufe 4+5: 6 m2 |
Stufe 4+5: Laufhof (3 m2/Tier) und Weidegang |
Ab Stufe 3: nicht erlaubt | Stufen 1-3: erlaubt Stufe 4: im Ausnahme- fall mit Betäubung erlaubt |
k.A. |
| Initiative Tierwohl | 1,5 - 4 m2 | k.A. | unter Auflagen erlaubt | Nur unter Sedierung und Schmerzmittelgabe | k.A. |
| Für Mehr Tierschutz |
Einstieg: 6 m2 Bewegungsfläche Premium: 9 m2 Bewegungsfläche (6 m2 Stallinnenfläche und 3 m2 ganzjährig verfügbarer Laufhof) |
Einstieg: k.A. Premium: ganzjährig Zugang zum Außenklima (Weide innerhalb der Vegetationszeit für mind. 120 Tage/Jahr und zusätzlich 3 m2 befestigter Laufhof) |
verboten | Nur unter Sedierung, Lokalanästhesie (Tierarzt) und Schmerzmittelgabe | 200 km / max. 4 h |
| EU-Öko- Verordnung |
6 m2 | Freilandauslauf mit mind. 4,5 m2/Tier | Für Klein- betriebe unter bestimmten Voraus- setzungen zulässig |
Kann genehmigt werden |
k.A. |
| Bioland | 6 m2 | Freilandauslauf mit mind. 4,5 m2/Tier | Für Klein- betriebe unter bestimmten Voraus- setzungen zulässig; bei Jungtieren < 1 Jahr verboten |
Bioland, Naturland: Kann genehmigt werden (dann mit Betäubung), Demeter: verboten |
200 km / 4 h |
Weitere Informationen
Oekolandbau.de: Werden Tiere auf Bio-Betrieben wirklich anders gehalten?